Thomas Brasch schreibt in seinem Tagebuch 1989 über „A.“ aus der Stargarder Straße.
Anlässlich seines 70igsten Geburtstages habe ich eine Episode aus dieser Zeit aufgeschrieben.
Wie Thomas Brasch um meine Hand anhielt
Brasch und ich gehen an einem Tag Ende September 1989 die Stargarder Straße im Prenzlauer Berg in Richtung Schönhauser Allee entlang. Es weht ein laues Lüftchen, die letzen Sonnenstrahlen tauchen den Gehweg in rötliches Licht. Es ist ein normaler Tag. Ich muss zur Arbeit.
Plötzlich fragt er leise mit gesenktem Kopf in den frühen Abend hinein: „Willst du mich heiraten?“ und bleibt an der nächsten Straßenlaterne stehen. Er umarmt diese, guckt nach den Autos auf der Straße, schwingt seinen Oberkörper etwas hin und her, bevor er meinen Blick aufnimmt.
Ich bin wirklich überrascht.
„Heiraten?“, wiederhole ich ungläubig und fühle mich sofort überfordert.
„Ja, heiraten“, wiederholt er in nun einem schon etwas verschmitzteren Ton und sagt es immer wieder vor sich hin. Mal gedehnt, mal hoch, mal tief. Mit einem Sprung in die Luft oder im Trippel-Schritt die Bordkante auf und ab hüpfend. Es könnte auch ein Balz-Tanz sein.
Er möchte nicht mehr über die Grenze hin und her zwischen Ost und West, er will zeigen, dass wir zusammen gehören. Und: Es sei vielleicht die letzte Chance in seinem Leben, sagt er. Er hatte entschieden, zu jemanden zu gehören.
Heute trifft es mich.
Zu Besuch bei meiner Familie in Dresden
Dresden ist eine schöne Stadt. Und, ja, die Dresdner Sachsen sind etwas behäbig und selbstverliebt, das haben ihnen der Barock, August der Starke und die Semper-Schule eingebrockt. Und sie verfügen hin und wieder über einen meckernden Ton, der sich trotzig an denen „von da oben“ reibt oder der sie beleidigt murren lässt, wenn sie sich benachteiligt fühlen. Doch nicht wenige sind auch in den Westen gegangen, andere sitzen noch immer auf ihren für die Ausreise gepackten Koffern, arbeiten dafür in Aushilfsjobs oder haben schon eine Wohnung in Berlin besetzt. Raus aus dem Tal der Ahnungslosen.
Die Einfahrt mit dem Zug über die Brücke ist wie ein Postkarten-Bild. Auf der linken Seite erscheint die Silhouette von Hofkirche und Brühlscher Terrasse, am Ufer davor die sich schlängelnde Elbe von breiten Elbwiesen eingesäumt. Im Sommer schaufeln Dampfschiffe durch das Wasser, flussabwärts an den Meißner Weinbergen vorbei, flussaufwärts in die Sächsische Schweiz. Liebliches Land. Egal ob die Zeiten rot oder schwarz sind.
Wir verlassen den Bahnhofsplatz und gehen über die Prager Straße, vorbei an den drei raumeinnehmenden Hotels Bastei, Lilienstein und Königstein, überqueren die Neustädter Brücke, schauen auf den Goldenen Reiter und laufen dann durch die kleinen dunklen, abgenutzten Straßen in der Neustadt. Eine Gaststätte in der Rothenburger Straße mit schmutzigen Gardinen und säuerlichem Geruch im Gastraum hat geöffnet. Wir bestellen Soljanka mit Weißbrot. Außer Fliegen an der Wand hat sich hier noch kein anderer Gast eingefunden. Auch nicht an der Theke. Wir löffeln die lauwarme Suppe. Danach steigen wir in die rote Tatra-Straßenbahn Nummer 11 in Richtung Weißer Hirsch, fahren bis zur Mordgrundbrücke, um von da aus den Elbhang zum Körner-Platz hinunter zu steigen. Im Körner-Garten neben dem Blauen Wunder trinken wir ein Bier. Brasch will hier an der Elbe sitzen bleiben. Auf den Kieselsteinen. Ganz nah. Und schauen. In die Weite. Er saugt förmlich den für ihn anderen Ort mit jeder Faser seines Seins auf. Er verreist nicht so viel. Hat Flugangst und wohl auch Angst, woanders nicht arbeiten zu können. Er schreibt eine Karte an Kathi, in der steht, dass er das Glück gefunden hätte.
Es wird Zeit. Ich habe meinen Eltern unseren Besuch angekündigt. Sie wohnen im Neubaugebiet Prohlis, das ist eine der Trabanten-Viertel, wie sie unter Honecker in allen Städten gebaut wurden. Wohnen im WBS 70. Plattenbau mit dem Vorzug warmen Wassers aus der Wand, Badewanne und Innenklo. Solch eine Wohnung Anfang der 80iger zu bekommen, war nicht einfach. Entweder man hatte viele Kinder oder war in der Partei, 19jährig im Eheglück mit Kind oder Schmiermittel zur Hand. Für unsere Familie waren das 70 Quadratmeter für vier Personen. Drei Zimmer mit Balkon im Erdgeschoss und Blick in der Achse auf eine Birke, Gaststätte, Kaufhalle und Poliklinik. Die Birke hatte ich gepflanzt. Küche ohne Durchreiche. Wenigstens das. Praktische Raumaufteilung bis in die Zeit der Pubertät, danach wurde es eng. Noch enger, als sich dann der Freund und das erste Kind meiner Schwester hinzugesellten, weil Wohnraum knapp war.
Aber heute war das dritte Zimmer für Gäste und Schreibtisch reserviert. Einiges hatte sich verändert. Das deckenhohe Regal mit dem Stoffvorhang im Flur neben der Wohnungstür war abgebaut, und es gab keine Türen mehr vor den Zimmern. Wir blieben also allesamt miteinander im Offenen. Auch in der Nacht.
Im Wohnzimmer stand der Couchtisch mit rauchfarbenem Glas und Messingbeinen. Das war modern wie auch die Hellerauer Schrankwand aus Holz und der HiFi-Turm, aus dem früher meine Mutter Adamos „Das kleine Glück“ oder mein Vater Gunter Gabriel „He, he Boss, ich brauch mehr Geld“ hörten. Ich setzte mich still auf die braun-gestreiften Couch, Brasch setzte sich neben mich. Er war kleiner als ich. Mein Vater saß uns im Sessel gegenüber. Meine Mutter war in der Küche, um das Abendbrot vorzubereiten. Im Fernseher liefen die Nachrichten. Es war ja eine spannende Zeit damals – 1989. Oder vielleicht lief auch „Ein Kessel Buntes“, weil es die Sendung war, in der es etwas Unterhaltung gab. Wortgeplänkel. Brasch redet und redet. Über die politischen Veränderungen und dass man doch die DDR reformieren müsse. Mit Gorbatschow in Moskau würden die Karten neu gelegt; da könnten doch nicht alle wie die DDR-Flüchtlinge aus Prag ausreisen.
Ich schweige.
Plötzlich geht Brasch auf die Knie, schaut zu meinem Vater hoch und sagt: „Ich halte hiermit um die Hand Ihrer Tochter an“. Damit meinte er mich. Mein Vater antwortet nicht, er ist verdutzt. Ich versuche mich immer kleiner zu machen und wünsche mich nach Berlin in meine Wohnung zurück.
Dann der Satz meines Vaters: „Haben Sie sich das auch richtig überlegt?“
Was soll das denn, denke ich und fühle mich wie eine Puppe, die man von der einen Stube in die andere versetzt.
Ja, natürlich habe er sich das überlegt. Großer Wunsch, passen zusammen, will man doch auch zeigen, endlich wieder eine Nähe in den Osten.
Wann?
Im Frühjahr.
„Dann feiern wir die Hochzeit in Dresden“, schließt mein Vater pragmatisch das Gespräch ab.
So klein war mir diese Wohnung trotz niedriger Decken noch nie vorgekommen.
Beim Abendessen zu viert rund um den Bauerntisch in der mit Holz verkleideten rustikalen Essecke wird munter über die Ausstattung, Personenzahl, den Ablauf und das Menü spekuliert. Ich esse so viel wie sonst nie. Mit vollem Mund spricht man nicht.
Am nächsten Morgen passt mich mein Vater in einem unbeobachteten Moment ab und fragt: „Willst du das wirklich? Der Mann ist 20 Jahre älter als du.“
Das stimmte, Brasch ist so alt wie meine Mutter.
„Hast du auch an die Zukunft gedacht?“
„An welche Zukunft?“, frage ich. Jetzt ist jetzt und ich will die radikale Veränderung.
Also sind wir zum Standesamt gefahren, um die Formalitäten abzufragen und zu klären. Das war alles nicht einfach, die Mauer stand zu diesem Zeitpunkt noch unverrückbar, und ob uns seine englische Staatsbürgerschaft zu einem unkomplizierteren Verfahren verhelfen würde, wusste die Beamtin beim besten Willen nicht zu beantworten.
Bevor wieder wieder zurück nach Berlin fahren, steht noch der Besuch bei meiner Großmutter an. Oh, wie bewunderte ich da Brasch, er konnte so charmant und formvollendet gegenüber alten Damen sein.
Es ist stickend heiß in der Wohnung. Und noch bevor wir uns zum Tee gesetzt haben, bekomme ich einen Einkaufsbeutel in die Hand gedrückt, um in den Gemüseladen „Am Ei“ zu gehen. Es sollte Bananen geben. Das bedeutet für mich anstehen und für den todmüden Brasch die Konversation mit meiner gebildeten Großmutter. Von der deutschen Literatur Eichendorffs bis Goethe, über Shakespeare, den sie – die vor dem Krieg Englisch und Germanistik studiert hatte – natürlich nur im Original las, bis zu den verpassten Lebenschancen auf der falschen Seite Deutschlands. Nach dem Krieg hatte sie ihre Schwiegermutter, ihre Mutter und ihre Tochter zu ernähren. Die Männer waren allesamt tot.
Als ich nach einer Stunde mit meinen Bananen im Netz zurückkomme, sagt sie zu mir: „Ach, es ist doch schön, dass du nicht den davor heiratest. Der hier ist wenigstens kein Jude“.
Für Brasch ist das der Witz des Tages.
Einige Zeit später steht der Termin für das Standesamt in Dresden-Neustadt fest und die goldenen, extra breiten Ringe, sind ausgesucht. Ich weiß, dass es wirklich ernst ist. Ich fasse mir ein Herz und springe ab.
______________________________________________________________
Weiterführende Beiträge:
> Wie ich Thomas Brasch entführte
Eine Matinee zum 70igsten Geburtstag von Thomas Brasch „In mein rotes Herz fällt Schnee“ zum 70igsten Geburtstag von Thomas Brasch ist am Sonntag, 22. Februar 2015, 11.00 Uhr im Berliner Ensemble. Katharina Thalbach, Ulrich Matthes, Martin Wuttke und Martin Schneider lesen Gedichte, Texte und aus Interviews von Thomas Brasch.
Zu seinem Geburtstag am 19. Februar 2015 trafen sich Freunde zur Lesung in der Rumbalotte im Prenzlauer Berg. Mit dabei waren Elke Erb, Katja-Lange Müller, Annett Gröschner und Peter Schneider.

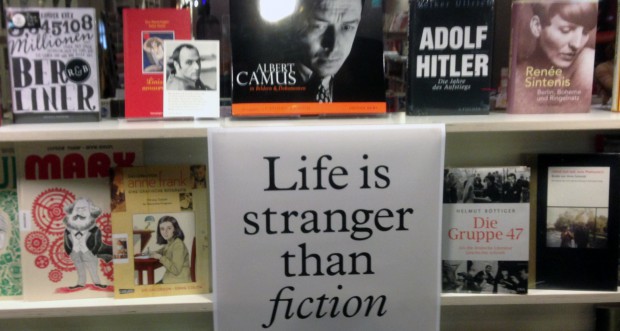
Pingback: Thomas Brasch: „Die nennen das Schrei“ - planet lyrik @ planetlyrik.de